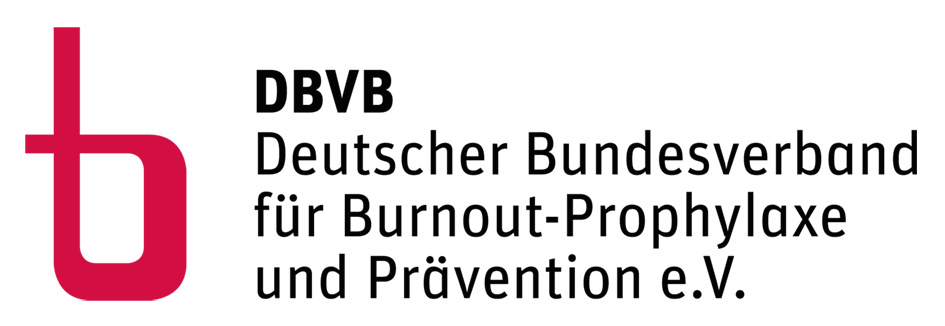Traumatherapie: Über die Krux verdrängter Erfahrungen

Susanne Nouar-Lührs, Diplom Psychologin, Traumatherapeutin und Dozentin bei campus naturalis, erklärt im Gespräch, wieso wir schlimme Erfahrungen erst einmal verdrängen und wie sie in ihrer Praxis mit Traumapatient*innen arbeitet.
Das Gespräch wurde geführt und aufgeschrieben von Wiebke Semm.
Wiederkehrende Flashbacks sind ein häufiges Symptom einer Posttraumatischen Belastungsstörung (kurz PTBS). Gewalt, Unfälle, Krieg, der Tod eines nahen Angehörigen: Solche Erlebnisse hinterlassen ihre Spuren. Doch ist vielen die Auswirkung von traumatischen Erfahrungen im Alltag gar nicht zwingend bewusst: sie führen ihr Leben, gehen zur Arbeit, „funktionieren“. Und auf einmal ist alles anders. Ein kleiner Moment oder eine Sache, ein sogenannter „Trigger“, kann negative, tief vergrabene Erinnerungen plötzlich allmächtig werden lassen.
Was ist ein Trauma?
Der Begriff „Trauma“ hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert und wurde von Hermann Oppenheim eingeführt. Der Neurologe behandelte an der Berliner Charité Opfer von Eisenbahn- und Fabrikunfällen. Neben den körperlichen Symptomen konnte er bei einer Vielzahl seiner Patienten auch psychische Folgesymptome feststellen, die er als eigenes Krankheitsbild einstufte. Wurde er damals für seine Arbeit belächelt, so wissen wir heute, dass traumatische Erlebnisse sich massiv auf Seele und Körper auswirken können. Im Duden wird ein Trauma als „starke psychische Erschütterung“ definiert, „die – im Unterbewusstsein – noch lange wirksam ist“
Auch Susanne Nouar-Lührs war aufgrund ihrer Berufswahl vielen seelischen Belastungen ausgesetzt. So arbeitet sie als Kinderkrankenschwester auf Intensivstationen und in der ambulanten Pflege. „Das Thema Tod und Sterben begleitete mich stark. Doch hatten wir auf der Station schlichtweg keinen Ort, wo wir über das Erlebte sprechen konnten. Ich habe mich damit sehr alleingelassen gefühlt“, sagt sie rückblickend. Aus dieser Gefühlsregung resultierte schließlich ihr Interesse an der Psychologie, welches sie mit einem Studium besiegelte. Doch erst durch die ergänzenden Ausbildungen im Bereich Körpertherapie und die zusätzliche Praxis im klinischen Setting, wurde Susanne das Thema Trauma zunehmend präsent. „Das war dann für mich wie ein Aha-Erlebnis, wo ich mich selbst auch als Betroffene wiedergefunden habe“, erklärt sie. „Es gab viele Schocksituationen für die Belegschaft, insbesondere auch für die Eltern, wenn das Kind plötzlich verstirbt. Doch der Tod galt lange als Tabuthema, mit dem man sich nicht so gerne auseinandersetzen wollte.“

Gerade für die Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, bedeuten schwere Schicksale eine extreme emotionale Belastung.
Welche Traumaformen gibt es?
Ob und wie stark sich ein Trauma manifestiert, hängt von individuellen Faktoren ab. Ein Schocktrauma oder eine akute Belastungsstörung nach einem Unfall ist häufig, weshalb neben Rettungskräften heute auch immer Seelsorgende vor Ort sind, um Betroffenen beizustehen. Die Chancen stehen dann meist gut, das Erlebte ohne Folgeschäden zu verarbeiten. „Wenn ich aber etwas Schlimmes erlebe und das nicht genügend bewältigen kann, dann wird das im Nervensystem weggesplittert“, veranschaulicht Susanne. Schockstarre, Taubheitsgefühle und wiederkehrende Flashbacks sind Anzeichen für ein ausgeprägtes Trauma, das auch nach Jahren noch bestehen kann. Etwas anders verhält es sich bei einem sog. Entwicklungstrauma, bei dem sich Erlebnisse mit der Zeit anhäufen. „Gerade in der Kindheit, wenn ich allein gelassen oder gedemütigt wurde, brennt sich das stark ins Unterbewusstsein ein.“

Versteckt, aber nie ganz weg: Traumatische Erlebnisse lassen sich nur zeitweise im Unterbewusstsein vergraben.
Was ist eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)?
Unser Körper ist darauf programmiert, schwere Belastungen und untragbare Situationen zu überstehen. „Es wird automatisch ein Schutzmechanismus abgespielt, was erstmal gut ist, um weiter zu funktionieren. Doch auf Dauer ist das keine Lösung, denn die negativen Gefühle und Erinnerungen werden nur weggeschlossen“, beschreibt Susanne den unterbewusst ablaufenden Prozess. „Das heißt: Die Gefühle werden nur in einen Dornröschenschlaf versetzt, können aber jederzeit aufbrechen.“ Ein Mensch kann sein Leben also trotz schwieriger Vergangenheit oder unverarbeiteter Erlebnisse bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz normal weiterführen. Das Erleben eines anderen (unerwarteten) Ereignisses kann diese Personen dann aber in ihren Grundfesten erschüttern, sodass alte Erinnerungen wieder ans Licht kommen und Gefühle aufbrechen. „Eine PTBS macht also nicht das aus, was ich erlebt habe, sondern die Symptome.“
- Gefühlserinnerungen (sog. Intrusionen),
- Flashbacks und Bilder, von denen Betroffene oft gar nicht wissen, woher sie kommen
- Und Angst- und Panikattacken
sind häufige Symptome einer PTBS. „Das kann auch noch älteren Menschen passieren, dass auf einmal Kindheitserinnerungen hochkommen und sich dann ein Trauma herausstellt oder eine multiple Persönlichkeitsstörung. Und das hat bis dahin kein Mensch mitbekommen“, macht Susanne die Vielschichtigkeit einer traumatischen Erkrankung begreifbar.

Wiederkehrende Flashbacks sind ein häufiges Symptom einer PTBS.
Wie behandelt man ein Trauma?
In ihrer Privatpraxis hat Susanne mit den verschiedensten traumatischen Ausprägungsformen zu tun. Ihre Behandlung richtet sich dabei ganz und gar nach den Bedürfnissen und dem Befinden ihrer Klient*innen. Mehr als bei irgendeiner anderen Therapieform benötigen Traumatherapeut*innen ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl und Empathie. Aussagen wie „Der Weg durch den Schmerz führt durch ihn hindurch“ sind bei der Traumatherapie nicht zielführend und alles andere als gewinnbringend. „Auf gar keinen Fall darf eine Retraumatisierung stattfinden. Ich kann also nicht einfach in eine schlimme Situation hineingehen und die Klientin oder den Klienten auffordern, diese noch einmal zu durchleben“, betont Susanne. Von einer Retraumatisierung spricht man, wenn sich eine posttraumatische Belastungsstörung verstärkt, weil ein Trauma erneut durchlebt wird. Deshalb ist es Susanne so wichtig, dass nicht sie, sondern die/der Klient*in den Behandlungsweg vorgibt. Das fängt bereits beim Erstkontakt an, bei dem auch Susanne ausgiebig beschnuppert wird. „Viele sind aufgrund ihrer Vorerfahrung unsicher und wollen erst einmal einschätzen, ob man mir vertrauen kann.“ Nicht selten hat sie es mit Patient*innen zu tun, die schlechte Erfahrungen mit Vorbehandlern gemacht haben. Stimmt die Beziehungsebene nicht, ist die Behandlung von vornherein zum Scheitern verurteilt. „Ich möchte zuallererst, dass sich mein Gegenüber wohlfühlt, erst dann frage ich, was sie/ihn zu mir führt.“ Bei dieser Schilderung gibt es für Susanne kein richtig oder falsch, auch wenn jemand z.B. noch Kontakt zum Täter hat. Eine Verurteilung der Bewältigungsstrategie oder auch „kluge“ Ratschläge sind in der Traumatherapie kontraproduktiv. Denn Susanne weiß, dass vielen Klient*innen, bereits der Weg in ihre Praxis schwerfällt und sie ihren Alltag nur schwer bewerkstelligen. „Es geht darum, den Menschen zu stärken und wertzuschätzen. Je nachdem, was der Mensch erlebt hat, geht das schnell oder dauert eben länger.“

Flüchtlingskinder sind aufgrund ihrer Erfahrung häufig von Traumata betroffen.
Wie hilft die körperorientierte Traumarbeit?
Besonders in der Traumatherapie äußern sich erlebte Traumata in
- somatischen Blockierungen
- Einschnürungen
- Verklebungen und Fixierungen
von Haltung und Wahrnehmung. Was einen Menschen seelisch belastet, schlägt sich meist auch auf sein körperliches Wohlbefinden nieder. „Wenn ich etwas Schlimmes erlebe oder erblicke, dann haben wir normalerweise einen Kampf- und Fluchtreflex. Das ist automatisch, das läuft über den Hirnstamm und das autonome Nervensystem und funktioniert bei Tieren sehr gut.“ Menschen seien bei der Verarbeitung aber insgesamt komplexer und können diese Anspannung nur schwer wieder selbst regulieren. „Das Trauma sitzt dann sozusagen weiterhin im Körper und Nervensystem“, beschreibt die Diplom-Psychologin, die zahlreiche körpertherapeutische Ausbildungen absolviert hat. „Diese Fixierungen in Körperhaltung und Bewegung der Menschen führen mitunter zu Hemmungen, Dissoziation und räumlicher Fehlorientierung.“ Durch die Bewegung-, Körper- und Tanztherapie sammeln die Patient*innen positive Erfahrungen und die Erkenntnis, selbst etwas bewirken zu können. Gleichzeitig eröffnet die körperorientierte Therapieform eine neue Ausdrucksmöglichkeit und stärkt die Ressourcen. Dieser Lerneffekt, der traumatischen Erfahrung nicht vollends ausgeliefert zu sein, macht Traumapatient*innen zunehmend handlungsfähig.

Durch die körperorientierte Traumatherapie gewinnt der/die Klient*in Handlungsfähigkeit zurück.
Welche traumatischen Erlebnisse sind aufgrund von Corona bereits spürbar?
Am Anfang war da der Schock, die Angst, und die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Die Isolation war für viele Menschen ein Problem sowie die damit einhergehenden Einsamkeitsgefühle. Aber auch das Masketragen, ein zur Eindämmung der Pandemie durchaus sinnvolles Konzept, ist für einige Traumapatient*innen problematisch. „Bei vielen haben diese Masken etwas ausgelöst, der eine bekommt Erstickungsängste, die nächste fühlt sich in ihrer Freiheit eingeschränkt und verfällt in Panik“, berichtet Susanne. Die Maske fungiert dabei wie ein Trigger, die einige unbewusst an eine Situation von früher erinnert. Aus diesem Grund gibt es Personen, die eine Maskenbefreiung haben, eben aus diesen gesundheitlichen Gründen. Doch daran denken die allermeisten nicht. „Diejenigen, die keine Maske tragen, werden von anderen dann angegangen und beschimpft. Da ist dann nichts mehr von Solidarität zu sehen“, gibt Susanne zu bedenken. Und das obwohl Menschen mit einer psychischen Vorerkrankung ohnehin schon oft zurückgezogen und verängstigt leben. „Ich hatte Klient*innen, die haben sich endlich mal wieder etwas getraut und wollten unter Leute gehen. Die strengen Kontaktregeln und die Angst vor Ansteckung haben sie jedoch wieder zurückgeworfen.“ Wie es um die psychische Gesundheit unserer Gesellschaft steht, wird in den Medien jedoch nicht ausreichend thematisiert. „Ich denke, dass es eine große Dunkelziffer gibt. Auch ich bemerke in meiner Praxis, dass es mehr Aggressionen gibt innerhalb der Familie, die Nerven blankliegen und Eltern überlastet sind.“

Das Tragen einer Maske kann für manche mit traumatischen Erlebnissen verknüpft sein, gerade auch in der kindlichen Entwicklungsphase.
Psychische Erkrankungen aufgrund von Corona
In der COPSY-Studie untersuchen Forschende des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf die Auswirkungen und Folgen der Corona-Pandemie auf die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Fast jedes dritte Kind leidet ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie unter:
- psychischen Auffälligkeiten
- Sorgen und Ängsten
- depressiven Symptomen
- und psychosomatische Beschwerden
So heißt es in einer Pressemitteilung des UKE im Februar 2021. Während Berichterstattung zur wirtschaftlichen Lage und die Vergabe von Impftermine die Medien dominieren, leiden viele Menschen im Stillen. „Da würde ich mir was anderes wünschen. Auf die psychischen Belastungen wird leider viel zu wenig geguckt“, sagt Susanne, die aufgrund der hohen Nachfrage nach Therapieplätzen nicht guten Gewissens Urlaub machen konnte. „Ich habe so viele Anfragen mittlerweile, obwohl ich eine Privatpraxis habe. Die Leute sind verzweifelt, die Leute suchen dringend nach Therapeut*innen.“
Wie werde ich Traumatherapeut*in?
Der Trend der hohen Nachfrage lässt sich auch auf entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten übertragen. Am campus naturalis ist Susanne seit 2012 als Dozentin in den Ausbildungsgängen Traumatherapie und Tanz- und Ausdruckstherapie tätig. In der Ausbildung zum*zur Traumatherapeut*in lernen die Teilnehmenden psycho-traumatologische Grundlagen und bekommen alle Werkzeuge an die Hand, um Traumata diagnostisch zu identifizieren. Außerdem stehen folgende Module auf dem Lehrplan:
- Unterschiedliche Störungsbilder und deren Diagnostik
- Grundwissen zum Thema Psychotraumatologie
- Körperorientierte Traumatherapie
- Techniken zur Stabilisierung und Psychoedukation
- Problemfelder in der Kinder- und Jugendarbeit
„Ich mache das bei Campus sehr gerne, den Studierenden etwas zu vermitteln. Das Theoretische, aber gerade auch das Praktische“, schwärmt Susanne. Auf die Verbindung zwischen Theorie und Praxis wird beim Campus großen Wert gelegt, wodurch die Teilnehmenden befähigt werden, traumatisierten Menschen zu helfen. „Gerade bei Trauma ist das Praktische und das Üben total wichtig. Das realisieren wir in Übungen, in denen wechselseitig die Rolle der Therapeutin bzw. des Therapeuten oder aber die Rolle der Klientin bzw. des Klienten eingenommen wird.“ Auf diese Weise werden die Teilnehmenden optimal auf ihre spätere Tätigkeit als Traumatherapeut*in vorbereitet.